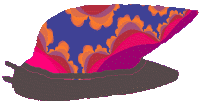
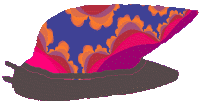
Idee, Ideal, Idealismus, Ideologie: Das sind vier Begriffe, die auf das griechische Verb idein [ιδειν] = sehen, erkennen, wissen zurückgehen. Parallel zu wissen erkennen wir das lateinische Verb videre = sehen. Wissen heißt eigentlich gesehen haben. Nachdem man etwas erkannt hat, weiß man, wie es ist. Alle Genannten entspringen der indoeuropäischen Wurzel ṷeid = erblicken, sehen.
Nicht alles, was der Mensch sieht, ist eine Idee. Zunächst sieht man das, was Tiere ebenfalls sehen: reale Objekte der physikalischen Welt. Bei niederen Tieren beschränkt sich das Sehen vermutlich auf das, was dem Auge unmittelbar zugänglich ist. Höhere Tiere und erst recht der Mensch sehen aber nicht nur, was die Netzhaut durch elektromagnetische Wellen reizt. Menschen nehmen über das sinnlich Erkennbare hinaus Bilder wahr, die im virtuellen Raum des Bewusstseins auftauchen: Erinnerungen, Ansichten und Ideen, die Alternativen zur faktisch erkennbaren Wirklichkeit bieten; und sie ergänzen. Nichts hat die Dynamik menschlicher Gesellschaften mehr beschleunigt als das.
Es gibt nur das Dasein. Ein Dortsein gibt es nicht. Da das Dasein den Menschen den Bedingungen aussetzt, die an dem Ort vorherrschen, an dem er sich befindet, ist das Dasein nur selten ein reines Vergnügen. Im Gegenteil: Den meisten wird es nicht schwerfallen, ihr Dasein überwiegend als Last zu bezeichnen. Vielen, die es nicht tun, fehlt nur der Vergleich zu einem Lebensgefühl jenseits der ständigen Sorge um das eigene Wohl.
Da das Dasein den Menschen auf Dauer kaum je zufrieden stellt, entwickelt er Ideen, wie es besser werden könnte. So ist das Dasein vom Wunsch durchsetzt, dort zu sein. Das Dort kann dabei ein faktisch anderer Ort sein oder eine Zukunft, die erfreulicher ist, als das, was man tatsächlich erlebt. Fast immer sucht der Mensch nach Bedingungen, die er für besser hält, als die, in denen er sich befindet. Die Karte, die er auf dem Weg ins gelobte Land benutzt, ist die Idee, wie es entgegen dem, was tatsächlich ist, eigentlich sein sollte.
Gefahrenabwehr
Das Leben ist gefährlich. Wenn man nichts dagegen unternimmt, wird man schnell aus der Welt entfernt. Kein Wunder, dass der Mensch sich fürchtet. Die Hauptaktivität des menschlichen Geistes besteht daher daraus, Ideen zu entwickleln, wie man künftigen Schaden verhindern kann. Man versucht, die Wirklichkeit zum eigenen Vorteil zu beeinflussen. Bei der Einflussnahme auf die äußere Wirklichkeit stehen drei Varianten im Vordergrund:
Das Bemühen um die Beeinflussung der Außenwelt geht bei vielen Menschen so weit, dass es fast ihre gesamte Ideenwelt absorbiert. Im Grundsatz macht es Sinn, einen Teil der Aufmerksamkeit darauf zu verwenden, die Außenwelt, insbesondere Bezugspersonen, zu beeinflussen. In der Regel wird aber zum Nachteil aller stark übertrieben. Viele Versuche, Einfluss zu nehmen, sind untauglich oder schädlich.
Wer ihn jetzt noch nicht hat, wird ihn bald bekommen: Hunger. Hunger ist das Symbol für die Bedrückungen der Existenz. Der Begriff kann dabei das leibliche Signal bezeichnen, das aufkommt, wenn der Zuckerspiegel im Körper unter seinen Sollwert sinkt; oder er ist eine Metapher für jede Form von Wünschen, die der Mensch ans Leben richtet; zum Beispiel die nach Wohlstand, Sicherheit, Anerkennung, Liebe und Freiheit.
Da man ohne Zufuhr überhaupt nicht leben kann und mit zu wenig Zufuhr schlecht, gehört es zum Repertoire normaler Verhaltensmuster, sich möglichst viele Güter anzueignen. Dazu gibt es drei Strategien:
Auch die Amöbe unterliegt der Notwendigkeit, sich geeignete Güter zu verschaffen. Ohne Gutes von außen kann sie nicht überleben. Ihre Strategie ist einfach. Mit Hilfe von Sensoren spürt sie genießbare Substanzen auf und steuert auf die günstigste Konzentration zu.
Was die Amöbe macht, macht auch der Mensch.
Bei all dem spielen Ideen keine große Rolle. Die Reaktionen erfolgen instinktiv; gesteuert von Mechanismen, die im Stammhirn verankert sind und keiner Verstärkung durch virtuelle Bilder bedürfen. Der sensorische Reiz, den die Wirklichkeit sendet, reicht aus, um das Verhalten des Empfängers zu steuern.
Mit der Strategie der Amöbe haben es Millionen Spezies weit gebracht und ebenso viele Jahre Evolution überdauert; allerdings zu einem hohen Preis: Je schematischer die Algorithmen sind, die den Kontakt zur Wirklichkeit regeln, desto höher ist der Verschleiß an Individuen.
Gezielter handeln Füchse und Elefanten. In der Trockenzeit läuft die Leitkuh nicht nur instinktiv irgendwo hin. Sie erinnert sich vielmehr individuell an Wasserstellen, an denen vergangenes Jahr etwas zu finden war. Der Fuchs lernt durch Erfahrung, wo Gänse zu stehlen oder süße Trauben zu finden sind. Elefant und Fuchs verwenden dazu Bilder. Sie haben eine Vorstellung von der Topografie ihres Lebensraums. Sie handeln nach Plan.
Pläne sind Ideen, die man sich über die Zukunft macht. Wer einen Plan nutzt, irrt nicht nur in der Stadt umher, um zufällig zu finden, was er sucht. Vielmehr vermeidet er Umwege und spart Energie. Die Rendite pro Einsatz wird somit gesteigert. Der Erfolg des Menschen beruht auf seiner Fähigkeit, komplexere Bilder als andere zu entwerfen. Er vergleicht die Wirklichkeit mit den Bildern, die er sich macht, und ergreift Maßnahmen, um sie den Bildern anzugleichen. Im überschaubaren Horizont persönlicher Anliegen hat diese Strategie guten Erfolg.
Der Möglichkeit, Bilder zu entwerfen, sind keine Grenzen gesetzt. Der Geist ist in der Lage, sich über Fakten und Gesetze hinwegzusetzen und die Wirklichkeit durch Modelle zu bereichern, von denen sie bis dahin keine Vorstellung hatte. In der Vorstellung kann man nicht nur die Füllung des Kühlschranks vorwegnehmen oder die Etappen, die zum Erreichen eines Diploms zu bewältigen sind. In der Vorstellung kann man Welten entwerfen, die kategorisch besser sind als die, in der man sich mit den Problemen pragmatischer Entwürfe befasst. Resultate dieser Möglichkeit sind Idealismus und Ideologie.
Dem Idealisten geht es nicht nur um die pragmatische Verbesserung seiner persönlichen Situation. Er glaubt, dass man das Leben durch die Einhaltung transpersonaler Tugenden, also solcher, die über den unmittelbaren Egoismus hinausgehen, grundsätzlich verbessern kann; und zwar bis zu einem Optimum, über das hinaus jede weitere Verbesserung überflüssig wäre.
Dabei fokussiert der Idealist das eigene Verhalten. Er versucht, dessen Muster so zu verändern, wie es seinen Wertvorstellungen entspricht und hofft, der Welt als Beispiel voranzugehen. Zum Glück gibt es solche Menschen; auch wenn die Welt ihnen kaum je soweit folgt, wie sie selbst es sich wünschen.
Ein Ideologe ist ein Idealist, der so von der Berechtigung seines Idealbilds überzeugt ist, dass er jede Infragestellung aktiv zu verhindern versucht und sich die Befugnis zuschreibt, alle erfolgversprechenden Mittel einzusetzen, um das Ideal zu verwirklichen. Während sich der Idealist auf die Optimierung des eigenen Verhaltens konzentriert, legt der Ideologe den Schwerpunkt auf die Veränderung gesellschaftlicher Strukturen. Da er davon ausgeht, dass Andersdenkende entweder verblendet oder böswillig sind, glaubt er, sein Zweck heilige die Mittel. Er glaubt, das Gute sei mit Gewalt zu erzwingen.
Unterschiede und Gemeinsamkeiten
| Der Idealist... | Der Ideologe... |
| stellt das Ideal über die Wirklichkeit. | |
| blendet aus, was dem Ideal widerspricht. | |
| bewertet alternative Sichtweisen als potenziell gleichwertig. | befürwortet oder betreibt die Entrechtung Andersdenkender. |
| beschränkt sich auf die Steigerung der eigenen Tugend. | organisiert sich zwecks politischer Machtausübung. |
| geht mit gutem Beispiel voran. | versucht, andere zur Gefolgschaft zu zwingen. |
Die Bildung weltanschaulicher Ideale spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation des seelischen Gleichgewichts. Den Vorteilen, die Ideale bieten, stehen Gefahren gegenüber.
Drei wesentliche psychologische Vorteile des Idealismus sind gut zu erkennen:
Idealismus ist der Glaube an das Vorrecht des Guten, des Schönen, der Liebe und der Gerechtigkeit. Das Bedürfnis, sich einer Vorstellung anzuschließen, die in eine lichte Zukunft weist, ist tief in der menschlichen Seele verankert. Vielleicht ist es sogar der Wesenskern des Menschen an sich. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er lebt von der Hoffnung auf eine Welt, die sich von ihrem Licht ernährt und deshalb frei von allen Übeln ist. Hoffnung ist der Glaube an eine Möglichkeit.
Tatsächlich sind Ideale aber nicht Teile einer besseren Welt, sondern jener, die man als zu schlecht empfindet, als dass man auf Dauer darin leben wollte. Die Verwechslung hypnotisiert den Betrachter des Bildes und macht ihn blind für zweierlei:
So träumen viele von etwas viel Besserem, aber einen Schritt darauf zu tun sie nicht. Sie bleiben beim Rausch, obwohl der Gewinn, den er vermittelt, sie nicht satt machen kann.
Was die Herkunft von Idealen betrifft, konkurrieren zwei Erklärungsmodelle:
Die einen gehen davon aus, dass das Ideale als fertige Gestalt vom Himmel offenbart wird. Sie glauben an einen absoluten Repräsentanten des Guten an sich, der Völkern ideale Gesetze zukommen lässt, an denen nichts verbessert werden kann und die folglich ewig zu beachten sind.
Die Psychologie beschreibt den Abwehrmechanismus der Idealisierung. Beim Entwurf einer Idealvorstellung entfernt das Individuum alle Aspekte, die negativ bewertet werden könnten, aus dem Bild, das er sich macht. Um das zu erreichen, bedient es sich weiterer Werkzeuge, die zwei Funktionen erfüllen: das Bild im ersten Schritt zu entwerfen und es im zweiten vor Infragestellung zu schützen.
Die Hypothese, dass Ideale, zum Beispiel als einzig wahrer Glaube vom Himmel verliehen werden, ist in sich bereits eine Idealisierung, die das Bild vor Zweifeln schützt. Die Wahrheit ist aber das, was Zweifeln standhält, nicht, was sie verbietet. Wenn jemand Zweifel verbietet, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er die Wahrheit nicht kennt.
Der Nationalist setzt seine Hoffnung ins Bild einer idealen Volksgemeinschaft, die ihren Mitgliedern dank überragender Eigenschaften ein optimales Leben verspricht, das durch eine dominante Position des eigenen Volkes vor den Anfechtungen des Umfeldes sicher ist. Während das idealisierte Gut des Nationalisten auf einer Legierung biologischer und kultureller Komponenten besteht, beruht der Schwerpunkt beim Rassisten primär auf biologischen Merkmalen. Nationalismus und Rassismus gehen ineinander über.
Kulturelle Muster können sich unabhängig von ethnischen Grenzen über größere Territorien erstrecken. Wird eine transnationale Kulturgemeinschaft idealisiert, schließt das die Idealisierung biologischen Merkmale weitgehend aus. In der Regel besteht die Grundlage transnationaler Kulturgemeinschaften auf mythologischen Bildern, die konfessionelle Systeme begründen.
Die Menschenwelt ist voller Ungerechtigkeiten, die man guten Gewissens nicht hinnehmen kann. Menschen, die nach Abhilfe suchen, entwerfen Gesellschaftsmodelle, von denen sie sich eine Lösung versprechen. In der Regel wird dabei die Komplexität der Wirklichkeit unterschätzt. Um glauben zu können, dass man eine gerechtere Welt eigentlich ganz einfach erreichen könnte, idealisieren sie ihre Entwürfe, um sie gegen Zweifel abzusichern.
Moralische Positionen sind typische Komponenten der drei genannten Komplexe. Eine moralische Position wird per se als so hoher Wert empfunden, dass ihre Infragestellung als tabu gilt. Dabei übersehen die Vertreter moralischer Positionen meist deren Relativität und ihre komplexe Verzahnung mit individualpsychologischen Interessen. Verstöße werden dementsprechend empfindlich sanktioniert.
Das Ideal gilt als Gipfel des Guten. Ideale sind makellose Bilder dessen, was erstrebenswert ist. Sobald es um die Frage geht, wie sich ein "guter Mensch" verhalten sollte, legen sie Maßstäbe fest. Sie übernehmen das Kommando und vergessen leicht, dass sie nur Bilder sind. Das Licht des Ideals erstrahlt so hell, dass man, geblendet von der Verheißung des makellos Guten, ernüchternde Tatsachen übersieht. Der gute Mensch läuft Gefahr, in ein Muster zu verfallen, das plakativ als Gutmensch bezeichnet worden ist.
Was den Gutmenschen vom guten Menschen unterscheidet, ist der Vorsatz, vor sich und anderen explizit als gut zu gelten. Gewiss: Auch dem guten Menschen gefällt es, als gut zu gelten. Beim ihm bestimmt das Bedürfnis aber nicht das, was er tut. Er ist nicht vorsätzlich gut, sondern beiläufig.
Sich als etwas Gutes zu betrachten, steigert das Selbstwertgefühl. Daher hat der Vorsatz, gut zu sein, eine narzisstische Komponente. Beim Gutmenschen dient der Vorsatz, gut zu sein, dem Ausgleich von Selbstwertzweifeln. Als Guter fühlt er sich den Schlechten moralisch überlegen.
Brennweiten
Man kann so von seinem Selbstverständis als guter Mensch erfüllt sein, dass man zu dessen Beweis vieles tut, was kurzfristig gut ist, langfristig aber schadet.
Gut zu sein heißt Teil zu sein. Gut zu sein heißt ein Teil zu sein, der zu dem Gegenüber passt, von dem aus er als gut beurteilt wird.
Zur Gemeinschaft zu passen, in der man lebt, hat Vorteile. Es vermindert Konflikte und damit Angst. Dem Guten macht es die Gemeinschaft leichter, dem Unguten setzt sie Widerstand entgegen. Als gut zu gelten, hat also nicht nur narzisstische, sondern auch soziale und damit handfeste Vorteile. Es erfüllt das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Der Vorsatz, als gut zu gelten, hat eine egoistische Komponente.
Der gute Mensch passt zu dem, was er ist; auch dann, wenn er dem Umfeld als unpassend erscheint. Der gute Mensch sagt, was er denkt; auch dann, wenn es nicht zum Konsens des Umfeldes passt. Der Gutmensch versucht sich passend zu machen, weil ihm der Mut fehlt, unpassend zu sein. Er wird vom Bedürfnis nach Zugehörigkeit beherrscht.
Vom Missbrauch der Moral
Als Repräsentant des grundsätzlich Guten erhebt sich das Ideal in die Unangreifbarkeit. Moral ist die Ermahnung, das Ideal zu ehren. Die Bereitschaft, sich über Menschen zu empören, die keine oder andere Ideale verehren, ist groß. Durch Empörung hebt sich der Entrüstete über den empor, den er von oben herab verurteilt. Moralische Empörung kann ein sinnvolles Werkzeug sein, um Missetäter einzuschüchtern.
Missbrauch der moralischen Empörung liegt vor, wenn sie nicht faktisch vollzogene Taten zulasten Dritter bekämpft, sondern Meinungsäußerungen, die unerwünscht sind. Wird Empörung eingesetzt, um das Ansehen Andersdenkender systematisch herabzusetzen, ist Moral von Hinterlist nur schwer zu unterscheiden.
Gesellschaftspolitische Idealismen übertragen das archetypische Grundmuster der intakten Familie auf die Gesellschaft als Ganzes. Deshalb sind sie zum Scheitern verurteilt.
Jede intakte Familie ist eine kommunistische Gemeinschaft. Die Mitglieder der idealen Familie treten den Gewinn ihrer jeweiligen Leistungen an die Gemeinschaftskasse ab, aus der jedem Mitglied das zugeteilt wird, was seine Bedürfnisse erfüllt. Die Leistungen, die jeder erbringt, entsprechen seiner Leistungsfähigkeit. Die Ansprüche, die jeder erhebt, werden mit den Ansprüchen der übrigen abgeglichen.
Die ideale Familie ist ein Modell, das nur selten vollständig verwirklicht wird. Meist ist die Realität sogar weit davon entfernt. Zu verwirklichen ist das Modell grundsätzlich nur, wenn sich alle Mitglieder ohne Vorbehalt der Gemeinschaft anvertrauen. Voraussetzung dafür ist, dass jeder jeden so gut kennt, dass das entsprechende Vertrauen zur Preisgabe des Egoismus überhaupt entstehen kann. Das ist nur durch engen, persönlichen Kontakt miteinander möglich.
Durch die Anonymität, die unausweichlich mit der Größe der Gemeinschaft zunimmt, ist eine Übertragung des idealen Familienmodells auf ganze Gesellschaften unmöglich. Egoismus dient der persönlichen Sicherheit. Kaum jemand ist bereit, auf ihn zu verzichten, wenn er nicht sicher sein kann, dass alle anderen es ebenfalls tun. Wie sollte er dessen aber sicher sein, wenn er die meisten anderen nicht kennt?
Wie sozialistische Idealismen sind auch Nationalismen und konfessionelle Gemeinschaften dazu verurteilt, ihre Ziele zu verfehlen. Eigentlich versprechen sie das Ende von Angst und Leid. In der Summe bringen sie mehr davon in die Welt.
Der Begriff Überforderung ist längst etabliert. Kein Wunder: Über Jahrhunderttausende hinweg lebte die Menschheit fast durchgehend aus chronischen Defiziten und damit aus Schwierigkeiten heraus, die die Bewältigungsstrategien vieler ständig zu überfordern drohten. Immerhin machte die Not den Menschen erfinderisch.
Der Nachkriegsgeneration bot die Geschichte ein Zeitfenster ungewöhnlich günstiger Konstellationen, sodass die Überforderung durch Lebensumstände für ein paar Jahrzehnte in den Hintergrund trat. Das durchschnittliche Repertoire intellektueller und psychologischer Fähigkeiten reichte aus, um sich als selbständige Person gesellschaftlich zu integrieren und ein Leben in wachsendem Wohlstand zu führen.
Durch die zunehmende Komplexität der postmodernen Gesellschaft rückt die Überforderung für viele wieder in den Vordergrund. Sich in der Komplexität beruflich und sozial zu etablieren, wird schwieriger. Die Hürden, die ein junger Mensch zu überwinden hat, um aus den Abhängigkeiten der Kindheit in die Selbständigkeit des Erwachsenen zu wechseln, werden höher.
Um die scheiternde Integration einer wachsenden Bevölkerungsschicht zu verhindern, hat die Politik ein breit gefächertes Repertoire an sozialen Förderungs- und Unterstützungswerkzeugen geschaffen. Während das Bündel der Werkzeuge einerseits Übles verhindert, hat es andererseits Folgen, die neue Übel schaffen.
Unterstützung hilft nicht nur. Sie verführt auch dazu, weniger auf die eigene Kraft zu vertrauen. Das führt zu dem, was die Psychiatrie als Hospitalismus kennt.
Die Beziehungsstruktur der Gastfreundschaft ist asymmetrisch. Der Gast wird vom Gastgeber bewirtet. Der Gastgeber sorgt sich um das Wohl des Gastes, während sich der Gast versorgen lässt.
Besonders in der Langzeitpsychiatrie kann beobachtet werden, dass die Selbstwirksamkeitskompetenz der Betreuten unter dem Einfluss übermäßig unterstützender Bemühungen ihrer Betreuer zurückgeht. Sie werden passiver, hilfloser und abhängiger. Diesen Rückschritt in die Hilfsbedürftigkeit nennt man Hospitalismus.
Heute gibt es ein so breites Spektrum sozialer Förderungs- und Unterstützungswerkzeuge für Hilfsbedürftige, dass die Vielzahl der Angebote nur noch durch eine wissenschaftliche Studie umfassend dargestellt werden könnte. Neben der Überforderung gibt es daher eine Überförderung, die das Problem, das sie beheben soll, ungewollt verstärkt.
Ursache des Problems ist auch hier Idealismus. Selbstverständlich gehört die Unterstützung sozial Schwacher zu jeder Gesellschaft, die als human gelten will. Zu glauben, eine optimale Sozialordnung, die möglichst alles zur Verfügung stellt, was jeden Mangel versorgt, sei in der Lage, das menschliche Leid aus der Welt zu schaffen, ist jedoch eine Idealvorstellung, die, unreflektiert umgesetzt, einen Kipppunkt erreicht, ab dem sie in der Summe mehr schadet als nützt.
Sollten Sie jemand sein, der auf Hilfsangebote angewiesen ist und ist es Ihr Ziel, sich davon zu befreien, dann nehmen Sie nur das an Hilfe an, was unbedingt nötig ist. Jede Bequemlichkeit, die man in Anspruch nimmt, hat ihren Preis.
Zwei Gründe führen dazu, dass gesellschaftspolitische Idealismen in Gewalt ausarten:
Die psychologisch begründete Sehnsucht nach einem Paradies, in dem endlich alle Leiden beendet sind, führt zur Übertragung kindlicher Erwartungen, die ursprünglich an eine intakte Familie gerichtet sind, auf größere Gemeinschaften oder die Gesellschaft als Ganzes. Da die Enttäuschung unausweichlich ist, der Wunsch aber tief verwurzelt, sind unbelehrbare Idealisten oft bereit, die Erde in eine Hölle zu verwandeln, um den Himmel zu erreichen.
Oben ist im Zusammenhang mit Idealismus von krimineller Energie die Rede. Zu Recht? Oder ist das polemisch?
Betrachtet man die Weltgeschichte, erkennt man zunächst zweierlei:
Das primäre Grundmuster des Menschen ist egozentrisch. In der Regel ist er bereit, die Realität zu seinen Gunsten auszulegen. Dazu gehört, dass er weitreichende Nachteile anderer, die durch seine Realitätsdeutung entstehen, billigend in Kauf nimmt.
Bei der Betrachtung der Geschichte erkennt man jedoch ein Drittes:
Anders ist es bei Fliesenlegern. Wenn ein Fliesenleger zu fairen Preisen gute Arbeit leistet, kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass er die Welt um ein Quäntchen seiner persönlichen Möglichkeit verbessert hat.
Die Gefahr, dass große Würfe daneben gehen, liegt nicht nur an der Distanz zum Ziel und der technisch verminderten Trefferwahrscheinlichkeit. Großen Entwürfen geht der Ruhm großer Bedeutung voraus. Je mehr man dem Wunsch folgt, möglichst viel zu gelten, desto größer ist die Versuchung, sich zum Agenten großer Entwürfe zu machen. Die Erfolgsaussichten großer Entwürfe werden nicht nur durch die Schwierigkeit geschmälert, sie technisch umzusetzen. Die Aussichten werden auch geschmälert, weil sich oft schon im Ansatz mehr Geltungsbedürfnis als inhaltliches Interesse an der Sache Geltung verschafft.
Vieles, was auf das Wohl anderer ausgerichtet zu sein scheint, dient tatsächlich der Steigerung des eigenen Selbstwertgefühls.
Ohne die Fähigkeit des Menschen, biologischen Vorgaben alternative Modelle entgegenzusetzen, die mehr Menschlichkeit verheißen, sähe die Menschenwelt noch bedrückender aus, als sie es sowieso tut. Auch beim besten Willen ist die Weitsicht des Menschen jedoch beschränkt; und zwar so weit, dass ihm auch das Ausmaß seiner Beschränkung kaum je bewusst wird. Intellektuell lebt der Mensch auf einer Insel. Was er von den Welten ahnt, die jenseits seines geistigen Horizontes liegen, ist vielfältigen Einschränkungen unterworfen. Während die Wirklichkeit jenseits des Horizonts mächtig auf die Welt in seinem Inneren einwirkt, kann ihre Wirkung beim Entwurf idealistischer Ideen nicht vorausberechnet werden. So kommt es, dass die Übertragung des Idealbilds auf die Wirklichkeit auf Hindernisse stößt.
Was helfen kann
Nur das zu tun, von dem man weiß, wie man es zu einem guten Ausgang führen könnte.
Das Scheitern des Ideals an der Wirklichkeit kann seinen Vertreter zusätzlich verbittern. Um mit der Enttäuschung klarzukommen, stehen ihm verschiedene Register zur Verfügung:
Im günstigen Fall nimmt der Idealist die Enttäuschung zum Anlass, das Bild zu überprüfen und bei einem Neuentwurf mehr Realität miteinzubeziehen.
Lösungsstrategien bei Enttäuschung
| konstruktiv | defensiv |
| Rücknahme der Verdrängung widersprechender Tatsachen | Verstärkte Verdrängung, Abwertung und Projektion eigener Untugenden auf vermeintliche Widersacher |
| Ernüchterung | Steigerung der Dosis |
Der Mensch misstraut der Wahrheit. Wie sehr, wird deutlich, sobald ihn die Wirklichkeit enttäuscht. Statt das Ende einer Täuschung zu begrüßen, wirft er der Wahrheit vor, dass sie es bewirkt. Oft ist er dem Wolkenkuckucksheim treuer, als der Wahrheit, mit der er leben soll.