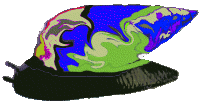
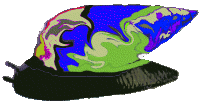
Geduld setzt sich aus der Vorsilbe ge- und dem Verb dulden zusammen. Die Vorsilbe benennt eine Versammlung. Dulden geht auf das althochdeutsche dolēn zurück. Leicht herauszuhören ist die Verwandtschaft des deutschen Verbs mit dem englischen to thole = leiden, dem schwedischen tåla = ertragen und dem gleichbedeutenden lateinischen Verb tolerare. Alle vier gehen auf die indogermanische Wurzel tel[ᵊ] = aufheben, wägen, tragen, dulden zurück. Geduld ist die umfassende Bereitschaft, Umstände anzunehmen, die als Last empfunden werden.
Jan ist eher von der stillen Sorte. Wenn forsche Leute auf der Party den Vordergrund füllen, versinkt er in einem Schweigen, das ihm unbehaglich ist. Nachdem er mehrfach die gleiche Erfahrung gemacht hat, bleibt er meist zuhause. Am PC wählt er Spiele, bei denen er sich durch mutige Entscheidungen nach oben levelt. An Erfolge im analogen Leben glaubt er kaum.
Jana ist keine Partylöwin. In Gegenwart anderer hört sie auch dann geduldig zu, wenn sie das Thema langweilt. Allein zuhause abzuhängen, ist aber keine Alternative. Sie beschließt, schrittweise selbstbestimmter aufzutreten und im Kontakt mit anderen öfter die Initiative zu ergreifen.
Der Mensch lebt in der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist ein ambivalentes Erfahrungsfeld, das dem Individuum einerseits Gelegenheit gibt, sich darin zu entfalten, das ihm andererseits aber Widrigkeiten entgegensetzt. Widrigkeiten kann man entweder beseitigen oder man kann es nicht. Kann man Widrigkeiten nicht oder noch nicht beseitigen, kommen unangenehme Gefühle auf, die Leid begründen: Angst, Wut, Hass, Langeweile, Neid, Gier, Scham, Schuld oder Trauer. Oder es kommt zu psychosomatischen Symptomen, die auf heftige seelische Konflikte hindeuten. Oft sind es diffuse Mischungen verschiedener Qualitäten. Ohne dass unangenehme Gefühle oder Stimmungen im Bewusstsein auftauchten, gäbe es nichts zu erdulden.
Die vier genannten Bedeutungen der indogermanischen Wurzel tel[ᵊ] beleuchten unterschiedliche Aspekte der Geduld:
Zunächst mag Geduld nur eine Folge der Tatsache sein, dass man einen Missstand nicht beseitigen kann und man ihn in der Folge zu ertragen hat. Man hält das Übel in der Hoffnung aus, dass es irgendwann vorübergehen wird. Hätte man ein Mittel, das Übel zu beseitigen, würde man es anwenden. Etwas zu ertragen ist Passivität. Es beinhaltet Leidensbereitschaft.
Mehr Weitsicht, als etwas bloß zu ertragen, beinhaltet Duldung. Etwas zu dulden ist ein freier Beschluss. Wer etwas duldet, könnte das Geduldete beseitigen. Er tut es aber nicht. Er tut es nicht, weil er durch das Geduldete momentan zwar Nachteile erfährt, er aber davon ausgeht, dass die Duldung des momentan Nachteiligen langfristig Vorteile bringt. Duldung ist ein Faktor gesellschaftlicher Liberalität und zwischenmenschlicher Akzeptanz. Fehlende Duldung führt zu Intoleranz und Konflikten.
Im Sinne von anheben: Man hebt etwas vom Boden hoch. Sie anzuheben, ist der erste Schritt, eine Last zu tragen; und mit sich mitzunehmen.
Bevor man etwas trägt, hebt man es auf. Was man aufhebt und in der Folge mit sich trägt, lässt man nicht zurück. Man gibt es nicht - wie Hans im Glück - für ein momentanes Wohlgefühl preis. Man bewahrt das Potenzial, das im Getragenen enthalten ist. Man kann es später für sich nutzen.
Etwas abzuwägen heißt, sein Gewicht und im erweiterten Sinne seine Bedeutung festzustellen. Wägen ist die ursprüngliche Form des Verbs wiegen. Es geht auf denselben Stamm wie bewegen zurück: indogermanisch ṷeĝh = sich bewegen, fahren.
Wem die Geduld fehlt, die Bedeutung auch unangenehmer Sachverhalte abzuwägen, dessen Bewegung wird ausgebremst. Geduld sorgt dafür, dass man vorankommt, indem sie hilft, die Welt zu verstehen. Umstände, die als misslich empfunden werden, können in größeren Zusammenhängen betrachtet wichtige Funktionen haben. Wer sich die Zeit lässt, die Bedeutung solcher Zusammenhänge richtig abzuschätzen, gewinnt Überblick und kann damit im Leben die Waage halten.
Wohlgemerkt
Geduld heißt nicht, die Erledigung von Unangenehmem auf die lange Bank zu schieben. Zu wissen, dass man noch etwas Unangenehmes zu tun hat, ist unangenehm. Zu wissen, dass man es hinter sich hat, erleichtert. Falls man noch etwas Unangenehmes vor sich hat, macht es Sinn, davon täglich etwas tun. Solange man Unangenehmes, das man erledigen könnte, nicht erledigt, wird es wie eine Hypothek verzinst.
| Unterschiede | ||
| Ungeduld | Geduld | Prokrastination |
| Ich versuche, mich Unangenehmem durch hastige Taten zu entziehen. | Ich beobachte die Lage, bis sich eine Lösung anbietet. | Ich schiebe Unangenehmes vor mir her. (lateinisch: cras = morgen) |
Ungeduld entspricht dem Impuls, in die Wirklichkeit einzugreifen, um Missstände möglichst schnell zu beseitigen. Dabei handelt es sich entweder um Eingriffe in die äußere oder in die innere Wirklichkeit. Eingriffe in die innere Wirklichkeit, also das persönliche Sosein, entspringen der Furcht, nicht zu genügen, wenn man so ist, wie man ist. Um Ungeduld zu überwinden, gilt es, in die Position des Beobachters zu wechseln. Der Beobachter unterlässt zunächst alle Versuche, etwas zu bewirken. Er sammelt Informationen, bis er verstanden hat, was tatsächlich zu tun ist.
Ungeduld heißt, aus dem Hier-und-Jetzt wegzudrängen. Dem können zwei Motive zu Grunde liegen:
| Ich will etwas bewirken, dem ich maßgebliche Bedeutung beimesse. | Ich will etwas erfahren, das ich im Hier-und-Jetzt nicht erfahre. |
Zur Geduld gehört die Bereitschaft, nichts zu tun. So könnte man meinen, dass ihr Wert bei aktiven Menschen nur wenig in Erscheinung tritt. Falsch gedacht! Es ist vielmehr so, dass die meisten Früchte menschlichen Tuns nicht nur Zeit zur Reife brauchen, sondern bis dahin kontinuierliche Pflege. Beziehungen wurden abgebrochen, Lernziele verfehlt, Projekte aufgegeben. Warum? Weil vieles nur durch Beharrlichkeit zu erreichen ist. Ohne die Bereitschaft, geduldig Erfolgen entgegenzugehen und dabei Widrigkeiten zu bewältigen, fehlt die Beharrlichkeit, die Erfolge brauchen.
Die wichtigste Voraussetzung der Geduld ist das Vertrauen. Logisch: Nur wer darauf vertraut, dass sich die Dinge letztlich zum Guten wenden, lässt sich die Zeit, die er braucht, um Widrigkeiten substanziell zu überwinden. Substanziell heißt: Die Widrigkeit wird nicht nur umgangen. Sie wird genutzt, um über sie hinauszuwachsen.
Werden Widrigkeiten nur umgangen, weil die Geduld fehlt, ihr Wesen zu verstehen, ist die Gefahr groß, dass ähnliche Widrigkeiten nicht lange auf sich warten lassen. Der Ungeduldige dreht sich oft im Kreise, was seine Ungeduld verstärkt. Der Geduldige lässt sich Zeit zu reifen, und kommt gerade deshalb schnell voran.
Erfreuliche Nebeneffekte
Langfristig trägt Geduld oft Früchte, auf die sie gar nicht ausgelegt war. Zuweilen ist sie eine tomatentragende Wollmilchkuh.
Gleichmut kann synonym zum Begriff Gelassenheit verstanden werden. Gleichmut ist ein wesentliches Merkmal seelischer Gesundheit. Der Begriff setzt sich aus gleich und Mut zusammen. Er zeigt an, dass der Gleichmütige dem Leben stets mit der gleichen Unerschrockenheit begegnet. Egal was passiert, der Gleichmütige verliert nicht den Mut. Rückschläge nimmt er als Herausforderungen an, die es zu bewältigen gilt.
Der Gegenpol des Gleichmuts ist der Wankelmut. Der Mut des Wankelmütigen hängt von der Qualität seiner momentanen Erfahrung ab. Erfährt er etwas Angenehmes, bekommt er Oberwasser. Wenn vordergründig alles gut läuft, wird seine Sicht auf die Dinge unrealistisch. Er glaubt, von jetzt ab werde es keine Rückschläge mehr geben. Schnell wird sein Verhalten leichtsinnig. Kommt der Rückschlag doch, wirft ihn das zurück. Sein Mut versinkt im Abgrund bitterer Verstimmung; was seine Möglichkeiten mindert, sich unverzagt an die Bewältigung des Problems zu machen.
Parteilichkeit
Während die normale Psyche auf das, was sie wahrnimmt, in der Regel parteiisch reagiert, bleibt die seelisch gesunde Psyche gleichmütig. Sie reagiert nur dann mit Nachdruck, wenn ein höheres Gut infrage steht.
Parteiische Reaktionen auf Elemente der Wirklichkeit können in zwei Kategorien aufgeteilt werden.
Das parteiische Ich versucht sich anzueignen, was ihm persönlich vorteilhaft erscheint.
Das parteiische Ich versucht das, was ihm persönlich nachteilig erscheint, von sich zu stoßen oder abzuwerten.
Das gleichmütige Ich verbleibt in Anbetracht dessen, was ihm begegnet, untätig. Untätig heißt: Es greift weder zu noch wehrt es ab. Es verbleibt in einem Zustand reinen Beobachtens. Es versucht zweierlei:
Geduld, Vertrauen, Gelassenheit und Gleichmut gehen Hand in Hand. Der Schlüssel dazu ist, die Bedeutung persönlicher Interessen nicht zu überschätzen. Wer bei allem, was er tut, zuerst an einen momentanen Vorteil denkt, fokussiert seinen Blick auf die Petitessen des Daseins. Die große Linie übersieht er.
Wer...
... hat ein vier-blättriges Kleeblatt gefunden.
Es gibt Menschen, die Geduld üben, solche, die resignieren und solche die ungeduldig auf sofortige Behebung misslicher Umstände drängen. Sie üben verschiedene psychologische Abwehrmechanismen aus.
setzt reife Abwehrmechanismen ein. Er antizipiert zukünftige Entwicklungen und setzt pragmatische Strategien ein, um erwünschte Veränderungen zu bewirken. Oder er sublimiert. Das heißt, er verändert seine Sicht auf die Welt dahingehend, dass der aktuell erlebte Missstand seine Bedeutung verliert und Wesentlicheres in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt. Er lässt Misslichkeiten hinter sich, indem er Kreatives vollbringt.
setzt auf Aktionismus. Er greift voreilig in die Wirklichkeit ein, ohne sich zu versichern, dass seine Eingriffe effektiv sind und ihre Nebenwirkungen nicht neue Probleme schaffen. Oder er versucht, Widrigkeiten zu überspringen und fällt bei der Landung auf die Nase.
vertraut nicht auf die eigenen Kräfte oder ist zu bequem dazu, sie einzusetzen. Lieber als nach Lösungen zu suchen, verdrängt er unliebsame Gefühle und Stimmungen durch betäubende Mittel, entlastet sich durch projektive Schuldzuweisungen oder stellt seine Progression im Leben ein, um Herausforderungen aus dem Weg zu gehen.
Geduld, Vertrauen, Gelassenheit und Gleichmut schaffen eine gesunde Distanz zur Welt und ihren Misslichkeiten. Das Gute ist: Man kann sie erwerben. Was man dazu braucht, ist die Bereitschaft, nach innen zu schauen, um Impulse zu erkennen, bevor sie in übereilte Taten übergehen.
Sie haben ein Smartphone? Gibt es alle naslang Töne von sich, die Sie dazu reizen nachzuschauen, wer sich gemeldet hat? Nehmen Sie die Töne wahr. Schauen Sie nach innen. Spüren Sie dort Neugier? Drängt es Sie dazu, zu erfahren, wer Ihnen etwas zu sagen hat? Nehmen Sie den Drang wahr, nachzuschauen, ohne ihm zu folgen. Bleiben Sie bei sich. Erleben Sie Neugier oder Hunger nach Beachtung, ohne sie zu stillen.
Sie sehen etwas Schönes, was Ihnen nicht gehört? Schauen Sie nach innen. Gibt es da eine Begierde, sich das Schöne anzueignen? Spüren Sie Neid, weil das Schöne einem anderen, aber nicht Ihnen gehört? Sagen Sie sich: Was ich jetzt spüre, ist Begehren oder gar Neid. So ist das eben. Das ist nicht schlimm. Es hat keine große Bedeutung.
Fragen Sie sich, warum Sie einem anderen dies oder das erzählen. Sie werden sehen, wie oft Sie versuchen, andere auf verdeckte Weise zu steuern. Das muss nicht sein. Bleiben Sie bei sich. Erleben Sie die Angst, die Sie vor dem Leben haben oder den Ärger darüber, dass der andere nicht Ihren Wünschen entspricht. So können Sie Angst und Ärger überwinden. Akzeptieren Sie, dass der andere denkt, was er denkt und so ist, wie er ist. Wer die Individualität des Anderen duldet, legt den Grundstein dafür, dass die Beziehung besser wird; und dass er sich selbst besser annehmen kann.