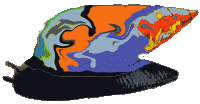
|
Seele und Gesundheit |
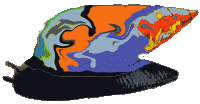
|
Seele und Gesundheit |
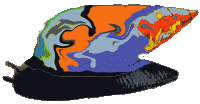
Der Mensch ist von der Idee beseelt, dass alles besser sein könnte. Die Idee stammt aus der Zeit, als sein Vorfahr als Mikrobe durch den Ozean schwamm und stets Gefahren ausgesetzt war. Mehr Licht, mehr Platz, mehr Nährstoffe? Her damit!
Obwohl der Mensch heute vielerorts unter Bedingungen lebt, deren Qualität alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt, ist sein Hunger nach Verbesserungen ungestillt. Das Gute ist nie gut genug, solange es etwas Besseres geben könnte. Allein, beim Griff nach dem Besten wird eins übersehen: Das Beste ist die Schwelle, an der das Gute ins Schlechte übergeht.
Rückenschmerzen können organischen Ursprungs sein, z. B.: Folge knöcherner Veränderungen der Wirbelkörper oder von Bandscheibenschäden. Oft sind sie aber psychosomatisch bedingt. Zwei Impulse stehen dann im Widerstreit:
Hört man vom Gegensatz zwischen aufrechtem Gang und gebeugter Haltung, scheint zunächst alles klar: Edel sei der Mensch, aufrechten Gangs und erhobenen Hauptes! So weit, so gut!
So einfach wie es scheint, sind die Verhältnisse aber nicht. Nicht immer ist es die falsche Wahl, sich zu beugen. Nicht bei jedem Konflikt mit dem Umfeld lohnt sich der Kampf. Nicht überall muss man eine konträre Sichtweise heroisch bekennen. Nicht selten ist es angemessen, sich weise einer Regel zu fügen, obwohl die Regel nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Wo es um wichtigere Dinge geht, kann es sinnvoll sein, auf den Stolz eines stets aufrechten Gangs zu verzichten.
Und außerdem: Wenn es einseitig um das Selbstwertgefühl geht, dem die aufrechte Haltung dient, kann es zu Paradoxien kommen. Wird der aufrechte Gang zu einem Ideal erklärt, dem man sich vermeintlich zu beugen hat, beugt man sich, obwohl man aufrecht zu gehen scheint.
Sobald Rückenschmerzen als Signal verstanden werden, dass über die Wahl zwischen oberem und unterem Weg zu entscheiden ist, ist zu klären, wohin der gewählte Weg überhaupt führen soll. Der obere Weg macht Sinn, wenn er eine Wunde des Selbstwertgefühls heilt. Oft macht er keinen Sinn, wenn er die Wunde bloß verdeckt.
Wer meditiert, sitzt still - wie ein braves Kind, das nicht stört. Wer ein braves Kind gewesen ist, kann sich fragen, ob sein Interesse an der Meditation nicht kindlichen Mustern entspricht. Wie das brave Kind erwartet der Meditierende einen Lohn für den Verzicht auf die Ausführung seiner Impulse. Beim Kind mag das die Zuneigung der Eltern sein. Beim Meditierenden ist es der Zugang zu höherer Erkenntnis.
Findet die Psyche während der Meditation keine Ruhe, kann das ein unbewusster Widerstand dagegen sein, sich in die Rolle eines braven Kindes zu fügen. Andererseits mag das brave Kind, das sich bereitwillig fügt, erst recht nach Höherem streben und so viel Geduld beim Stillsitzen aufbringen, bis sich das Höhere öffnet. So kann die frühkindliche Prägung dem Erfolg spiritueller Bemühungen ebenso im Wege stehen wie Vorschub leisten.
In der spirituellen Praxis ist die Desidentifikation von Körper und Ego ein gängiges Mittel um das Selbstbild über den Horizont beider hinaus zu erweitern.
Der Desidentifikation kann aber auch ein neurotischer Abwehrmechanismus zugrunde liegen, der das Selbstbild nicht ins Heilsame erweitert, sondern durch Spaltung beschädigt.
Manuel wurde als Kind weit weniger freudig begrüßt, als es unter besseren Bedingungen möglich gewesen wäre. Im Sinne eines Wiederholungszwangs agiert er das Gefühl, abgelehnt zu werden, aus, indem er sich von sich selbst und seinem Körper lossagt.
Fazit: Spirituelle Techniken, als deren Resultat der Körper nicht mehr wertgeschätzt wird, als vor ihrer Anwendung, sind verdächtig. Wer Körper und Person abwertet, spaltet, statt sich zu etwas Ganzem zu vereinen.
Dass Meditation nicht nur heilsame Effekte hat, sondern auch seelische Turbulenzen auslösen kann, ist bekannt (z.B.: Willoughby Britton). Die introspektive Konfrontation mit seelischen Konflikten kann Ängste, Schlafstörungen und Depressionen triggern; gegebenenfalls sogar eine Psychose.
Meditation kann mit so viel Ehrgeiz betrieben werden - um endlich die verheißene Erleuchtung zu erlangen -, dass sie zu einen Stressfaktor wird; vor allem, wenn die Desidentifikation von Körper und Person mit einer autoaggressiven Vehemenz erfolgt. Denkbar ist, dass sie dann autoimmune Reaktionen verstärken oder sogar anstoßen kann.