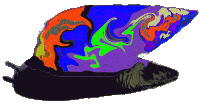
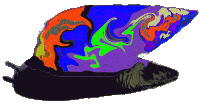
Verwechslungsgefahr
Recht
Schränke mich nicht ein. Lass mich in Ruhe. Lass mich frei.
Anspruch
Gib mir, was ich haben will. Schränke dich zu meinem Vorteil ein. Unterwirf dich mir.
Wer einen Anspruch erhebt, spricht andere an. Dasselbe passiert bei der Ansprache. Indem man zum anderen spricht, teilt man Informationen mit. Während die Zielsetzung der Informationen bei der Ansprache verschieden sein kann, ist sie beim Anspruch immer die gleiche. Wer einen Anspruch erhebt, fordert vom anderen, dass der ihm etwas gibt.
Da sich der Anspruch der Sprache bedient, ist klar, dass er nur Sinn macht, wenn es jemanden gibt, der die Sprache versteht und darauf reagieren kann. Im zwischenmenschlichen Bereich ist das der Fall. Man kann andere gezielt ansprechen, um Ansprüche anzumelden und durchzusetzen.
Unklar ist, ob ein Anspruch, der über die soziale Gemeinschaft hinausweist, Sinn macht. Einverstanden: Ansprüche kann man nicht nur gegenüber eigenen Artgenossen, sondern auch gegenüber Hunden, Pferden, Elefanten und Delfinen anmelden. Es ist möglich, mit Tieren bestimmter Spezies so zu kommunizieren, dass sie verstehen, was man von ihnen erwartet. Die entsprechenden Individuen sind daher Mitglieder der sozialen Gemeinschaft.
Ein großer Teil menschlicher Ansprüche richtet sich jedoch nicht unmittelbar an andere Personen, und schon gar nicht an Tiere. Ein großer Teil unserer Ansprüche richtet sich an das Leben an sich. Wir erwarten, dass unser Leben so und so zu sein hat, und wir sind keineswegs bereit, gröbere Abweichungen vom Soll als vollgültiges Leben anzuerkennen. In Abgrenzung zu sozial adressierten Ansprüchen kann man solche Ansprüche in Ermangelung eines besseren Begriffs als existenziell bezeichnen. Existenzielle Ansprüche erhebt man an das Dasein an sich bzw. an die Instanz, die man dafür verantwortlich macht.
Hohe und berechtigte Ansprüche
Sinnvoll ist, davon auszugehen, dass Ansprüche, die man ans Schicksal richtet, grundsätzlich zu hoch sind. Erst wenn man erkennt, dass überhaupt kein Anspruch gegenüber dem Schicksal besteht, hat man den Boden der Tatsachen erreicht. Von dort aus kann man tun, was nützlich ist, ohne auf die Erfüllung dessen zu pochen, worauf man vermeintlich Anspruch hat. Existenziell gesehen steht niemandem irgendetwas zu. Alles ist Gabe, die man annimmt oder nicht; auch man selbst. Wer auf Ansprüche gegenüber dem Leben nicht verzichten will, muss sie selbst erfüllen.
Mit dem Anspruch verwoben ist das Privileg. Der Begriff Privileg wird heute als Vorrecht verstanden. Vorrecht heißt: Es besteht von vorn herein ein Anspruch auf Erfüllung. Ein Vorrecht ist eine Mitgift, die einem bestimmten Individuum mit auf den Weg gegeben ist. Privileg enthält zwei lateinische Wurzeln: lex = Gesetz und privus = einzeln, gesondert. Privus ist mit lateinisch privare = trennen, berauben verwandt. Wer sich für privilegiert hält, geht davon aus, dass ihm eine besondere Position zusteht, die anderen gesetzlich vorzuenthalten ist.
Soziale Adressaten für Ansprüche sind leicht identifizierbar. Sie stehen uns als leibhaftige Individuen gegenüber. Ein großer Teil der sozialen Interaktion besteht aus Anmeldung, Erfüllung oder Zurückweisung von Ansprüchen. Das gilt für das persönliche Umfeld ebenso wie für das überpersönliche Beziehungsgefüge der Gesellschaft als Ganzes.
Das gesetzlich geregelte Gerüst der Gesellschaft besteht weitgehend aus Legalisierung und Begrenzung sozialer Ansprüche. Legalisierung legt fest, wer unter welchen Umständen die Macht des Staates für sich in Anspruch nehmen kann, um seine Rechte gegen die Ansprüche anderer zu verteidigen bzw. eigene Ansprüche gegenüber anderen durchzusetzen. Politik schützt Eigentum vor dem Zugriff anderer oder sie legalisiert ihn; je nachdem, wer die Macht hat.
Als Adressaten existenzieller Ansprüche stehen verschiedene Kandidaten zur Wahl. Einen kann man tatsächlich zur Verantwortung ziehen: sich selbst. Die anderen sind Vorstellungsbilder, von denen man glauben kann, dass sie nicht nur Bilder sind, sondern Ausdruck mächtiger Instanzen, die man für sich gewinnen kann. Oder man glaubt es nicht.
Dabei ist klar: Eine Gottheit, die über mein Leben bestimmt, ist ein personalisiertes Schicksal, das nicht würfelt, sondern Entscheidungen trifft.
Jeder hat ein Selbstbild, also eine Vorstellung...
Dem Selbstbild steht das eigene Sosein gegenüber, das mehr oder weniger genau erkannt und mit den Soll- und Wunschanteilen des Selbstbilds verglichen wird. Stellt man zwischen Ist und Soll einen Unterschied fest, kann man auf zweierlei Art reagieren:
Ich bin anders als ich sein sollte oder mir zu sein wünsche. Das ist in Ordnung. Es ist kein Defizit. Es ist bloß eine Tatsache. Wie ich bin, hat Vorrang vor dem, wie ich sein sollte. Der Wunsch, anders zu sein, als ich bin, gehört als Element meines Soseins zu dem, was ich bin, ohne dass der Wunsch einen Anspruch darauf hätte, erfüllt zu werden. Falls der Wunsch in Erfüllung geht, freut mich das. Falls nicht, bleibt er unerfüllt, ohne dass das den vollgültigen Wert meines Daseins schmälert.
Menschen hadern mit dem Schicksal. Wer mit dem Schicksal hadert, zeigt an, dass er Erwartungen an das Leben hat, die er als berechtigte Ansprüche empfindet, die über das hinausgehen, was ihm gegeben ist oder was er selbst bewirken kann.
Erwartungen fußen aber oft nicht nur auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen, sondern auf Ansprüchen, die man zukünftigem Leben entgegenbringt.
Das können Vermutungen über zukünftige Verläufe sein, oder Ansprüche, die man sich selbst oder anderen gegenüber erhebt. Erwartungen, die zugleich Ansprüche sind, sind normativ. Sie versuchen, der Zukunft vorzuschreiben, wie sie zu sein hat.
Bereits die heidnischen Mythologien der Antike haben das Schicksal als Werk göttlicher Kräfte beschrieben. Bei den Griechen waren es die Moiren, bei den Römer die Parzen. An die Stelle der vielen Götter der heidnischen Welt rückte später der eine Gott des Monotheismus.
Während man den Zusammenhang zwischen dem Treiben der heidnischen Götter und dem Schicksal des Einzelnen vergleichsweise locker sah, wird die Bindung zwischen dem einen Schöpfergott und seinen Geschöpfen als allumfassend aufgefasst. Dem entsprechend wendet sich der gläubige Monotheist mit all seinen wesentlichen Anliegen an den Himmel. Er sieht sich in einem unauflöslichen Bund mit seinem Gott, und geht - meist ohne sich einzugestehen, dass es Ansprüche sind - davon aus, dass aus der eigenen Bündnistreue Ansprüche erwachsen, die von Gott zu erfüllen sind. Der Gläubige ergeht sich in sichtbarer Demut und glaubt, gerade diese Demut berechtige ihn, mehr Gunst von Seiten Gottes zu erwarten, als er ohne Demut zu erwarten hätte.
Theoretisch kann man soziale Ansprüche von existenziellen klar unterscheiden. Da die menschliche Existenz aber überwiegend von sozialen Erfahrungen bestimmt wird, ist die Unterscheidung in der Praxis schwer zu treffen; oder gar nicht möglich, weil die Dinge intim miteinander verzahnt sind.
Ich erwarte, dass ich Karriere mache. Karriere ist stets in den sozialen Kontext eingewoben. Sobald ich meinen eigenen Anspruch erfüllt habe, so leistungsfähig zu sein, wie es ein bestimmter sozialer Rang erfordert, bedarf es zur Berufung an die entsprechende Stelle der Anerkennung durch andere.
Aus dem Anspruch, den ich an mich und mein Schicksal habe, erwächst ein Anspruch gegenüber anderen. Wird er nicht erfüllt, habe ich den Eindruck, dass mich die Gemeinschaft nicht angemessen wertschätzt. Fehlende Wertschätzung durch andere kann als eine Verletzung der Ehre gedeutet werden und heftige aggressive Impulse auslösen.
Der materielle Grund liegt in den faktischen Vorteilen, die durch den Anspruch angestrebt werden.
Da ein Anspruch einer Aggression bedarf, mit deren Hilfe er durchgesetzt wird, steigert die Formulierung von Ansprüchen gesellschaftliche Spannungen. Die repräsentative Demokratie droht in verfeindete Lager zu verfallen, die sich mit wachsender Aggression bekämpfen. Die Anspruchsgesellschaft fördert ihren eigenen Verfall. Je höher die Summe aller Ansprüche in einer Gesellschaft, desto eher fällt sie ihrer Dekadenz zum Opfer.
Eben hieß es, ein Anspruch sei ein narzisstischer Gewinn, der Abhängigkeiten festigt. So ist es auch. Denn die Kehrseite eines Anspruchs ist die Unfähigkeit, mit etwas Gegebenem zufrieden zu sein. Das Eingeständnis dieses Unvermögens ist dem entsprechend eine heilsame Ernüchterung, die den Weg zu größerer Zufriedenheit ebnet. Das Eingeständnis fällt umso schwerer, mehr man sein Selbstwertgefühl mit der Höhe der eigenen Ansprüche verbindet.
Nicht jeder Anspruch erfüllt das Kriterium, überflüssig und potenziell schädlich zu sein. Ansprüche, deren Erfüllung notwendig ist, sind getrost zu erheben, wenn ohne ihre Erfüllung eine Not entstünde, die durch die Erfüllung leicht abzuwenden ist. Problematisch sind Ansprüche erst dann, wenn sie vorwiegend narzisstisch motiviert sind. Narzisstisch motivierte Ansprüche münden in einen Teufelskreis. Statt das Problem zu lösen, das sie ins Leben ruft, verdecken sie es bloß.
Jeder narzisstisch motivierte Anspruch blendet den, der ihn erhebt. Er lenkt seinen Blick von dem ab, was ist - der Unfähigkeit, mit sich selbst zufrieden zu sein - und rückt das in den Fokus des Bewusstseins, was angeblich sein soll. Je weniger man aber das erkennt - und als gegeben anerkennt - was tatsächlich ist, desto weniger versteht man von der Wirklichkeit, in der man sich zurechtzufinden hat. Je weniger man sich in der Wirklichkeit zurechtfindet, desto unangenehmer sind die Gefühle, die durch die Begegnung mit ihr hervorgerufen werden. Je unangenehmer die Gefühle, desto größer ist die Gefahr, dass man den Anspruch erhebt, die Wirklichkeit sollte anders sein. Man riskiert, das Leben zu entwerten, das man momentan erfährt.
Wie dem auch sei: Schmollen hat etwas mit Ansprüchen zu tun. Niemand schmollt, ohne damit darauf hinzuweisen, dass seine Ansprüche nicht erfüllt sind. Zugleich soll das Schmollen Druck auf den Adressaten ausüben und ihn zur Erfüllung der Ansprüche bewegen. Wer schmollt, teilt dem anderen mit: Du stehst in meiner Schuld. Tue etwas, um sie zu tilgen!
Wer die Untauglichkeit des Schmollens als Werkzeug fruchtbarer Kommunikation erkennt, mag darüber Schmunzeln, wie oft er sich bereits dieses problematischen Mittels bedient hat.
Wenn man mit anderen schmollt, kann es sein, dass man sie damit in die Flucht schlägt. Dann ist man sie los. Dicker kommt es, wenn man mit dem Leben schmollt. Während sich Menschen, die man mit Ansprüchen bedrängt, gegebenenfalls vom Acker machen, bleibt das Leben vor Ort. In den Praxen der Psychotherapeuten wimmelt es von Menschen, die mit dem Leben schmollen. Es wimmelt von Menschen, die weder die Welt noch sich selbst akzeptieren, wie sie sind, sondern Ansprüche erheben, die das Leben nicht erfüllt. Ursache ist ein mangelndes Selbstwertgefühl.
Betrachtet man die Wirklichkeit aus der egozentrischen Perspektive heraus, pocht man gerne auf sein Recht. Die Ursache ist klar: Im egozentrischen Modus interessiert man sich nur bedingt für die Wirklichkeit. Was wahr und unwahr ist, will man nur soweit wissen, wie man die Welt damit zu seinem Vorteil verändern kann. Da man Recht und Anspruch meist gleichsetzt und Anspruch nichts anderes ist als die Forderung, bevorteilt zu werden, klammert man sich lieber an die Illusion, Recht zu haben, als eine Wahrheit einzusehen, die man für nachteilig hält.
Durch den Trotz, mit dem man im egozentrischen Modus auf sein Recht pocht, schneidet man sich ins eigene Fleisch. Wenn man etwas zu seinem Vorteil verändern will, das man kaum verstanden hat, wird die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns erhöht. Im Glauben, am besten zu wissen, was richtig ist, bastelt man am Motor des Lebens herum, ohne zu wissen, wie der überhaupt funktioniert.
Ansprüche werden durch Gefühle in Bewegung gesetzt. Ist das, was ich erlebe, angenehm, erhebe ich nicht den Anspruch, dass es anders sein sollte. Oft ist das, was man erlebt, aber nicht angenehm, sondern unerfreulich. Dann steht man vor der Wahl:
Man nimmt das unerfreuliche Gefühl ohne Widerstand zur Kenntnis. Man akzeptiert, dass es im Leben seinen Platz hat.
Unangenehme Gefühle als minderwertig abzutun, weil man den Anspruch erhebt, angenehme zu haben, verhindert, dass sie als Erfahrung fruchtbar werden. Eine Lösung besteht in der radikalen Akzeptanz aller Gefühle, die man erlebt. Radikale Akzeptanz geht davon aus, dass auch im Unangenehmen etwas Gutes enthalten ist. Für viele Entwicklungen ist Leid als Auslöser notwendig.
Wer dankbar ist, erkennt an, dass er Gutes erhalten hat. Das wird zunächst dem Geber nützen, weil es den Wert seiner Gabe und damit auch ihn bestätigt. Darüber hinaus festigt Dankbarkeit Bindungen. Das ist zu beider Seiten Vorteil.
Wer anerkennt, dass es Gutes gibt, wird sich der Welt zuwenden; und nur, wer sich der Welt nicht verschließt, weil sie auch Übles enthält, kann überhaupt Gutes empfangen. Daher macht es Sinn, dem Himmel für allerlei zu danken, obwohl wir nicht wissen, ob ihm unser Dank etwas wert ist. Uns nützt Dankbarkeit allemal. Sie verhindert, dass uns Ansprüche gefangen nehmen.
Fazit: Danken Sie dem Himmel dafür, dass er Ihnen eine Erfahrung ermöglicht hat. Nicht nur für die angenehmen. Am besten für alle.
Ein Gegenpol zum Anspruch ist Verzicht. Wer Ansprüche aufgibt, verzichtet auf ihre Erfüllung. Manchmal ist Verzicht an sich von Vorteil; wenn man auf einen Genuss verzichtet, der offensichtlich schadet. Oft nützt Verzicht aber auch, wenn ein Nachteil zunächst nicht erkennbar ist. Vieles, was man ständig in Anspruch nimmt, verdeckt, wie sehr man davon abhängig macht. Jenseits eines solchen Verzichts kann man finden, was mehr Freude macht als das, worauf man verzichtet hat.
Kluger Verzicht ist großer Gewinn. Wer klug verzichtet, muss es nur selten tun. Er kann sorglos genießen, was frei macht; weil Genuss an sich kein Schaden ist. Genuss wird erst zum Schaden, wenn er verhindert, dass man Größeres erkennt. Genuss, der als Dank an den Himmel vollzogen wird, ist ein Genuss, der die Geschenke des Himmels anerkennt.